Seit dem Sommersemester 1992 sind die ersten Studis in NRW mobil, Wuppertal folgte ein Jahr später
Die FH Darmstadt führte, auf Initiative zweier Studenten, als erste Hochschule im Wintersemester 1991/92 ein Semesterticket ein. Der Preis: 14 Mark. Die Motivation, auch der später folgenden Studierendenvertretungen in NRW, war vor allem umwelttechnischer, aber auch sozialer Natur. Bis dahin fuhren nur 16 von 100 Studierenden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Über zwei Drittel nutzten hingegen das Auto und sorgten so für Verkehrs- und Parkplatzprobleme in den Hochschulstädten.
„VRR statt GTI“
So betitelte ZEIT-Redakteur Jochen Leffers seinen Artikel zur Einführung des Semestertickets in NRW. Für 84 Mark kamen Dortmunder Studierende im Sommersemester 1992 als Erste in den Genuss eines Semestertickets. AStA, VRR und die Landesregierung NRW arbeiteten gemeinsam an der Umsetzung dieses Pilotprojekts. Ein Erfolg, wie sich kurze Zeit später herausstellte. Bis 1994 folgten bereits Dutzende Hochschulstandorte, die ebenfalls das Semesterticket einführten.
Doch war das Ticket nicht frei von jeglicher Kritik. Einerseits wurde der Preis als zu hoch kritisiert, andererseits der Zwang zur Abnahme durch alle Studierenden gar gerichtlich angegriffen. Ein Student der damaligen Gesamthochschule Duisburg ging bis zum Bundesverfassungsgericht. Die Richter sahen im Semesterticket jedoch keine Verfassungswidrigkeit gegeben. Das Semesterticket sei durch die „verfolgten Gemeinwohlbelange gerechtfertigt“ und biete eine „Verbesserung der sozialen Situationen der Studierenden“.
Wuppertal verspätet sich
Wuppertal folgte erst ein Jahr nach Dortmund. Der Preis verhinderte eine frühere Einführung. Die hiesige Studierendenschaft wurde zur Urabstimmung aufgerufen. Eine deutliche Mehrheit votierte für eine Ticketeinführung. Einzige Einschränkung: Der Preis sollte 30 Mark pro Semester nicht übersteigen. Der übrige Betrag sollte durch Landeszuschüsse gedeckt werden. Die breite Einführung des Tickets im Wintersemester 1992/93 (u.a. in Bielefeld und Bochum) und eine Absage vom Land ließen etwaige Bestrebungen platzen. Gebunden an das Votum musste jedoch erneut über die Einführung abgestimmt werden.
Bei einer 45%-igen Wahlbeteiligung stimmten 87% der teilnehmenden Studierenden wieder für eine Einführung. Das notwendige Quorum einer Zustimmung von 30% der Studierendenschaft wurde mit 39% deutlich überschritten. Ab dem Sommersemester 1993 waren dann auch die Wuppertaler StudentInnen mobil.
Stärkere ÖPNV-Nutzung
Studien belegen an Hochschulstandorten mit Semesterticket eine generelle Verlagerung vom Auto hin zum ÖPNV – ein Punkt für die Umwelt. Ferner steigt die Mobilität des einzelnen Studierenden, deren Anteil an Autobesitzern kontinuierlich sinkt.
Auch an dem sich nahe an einem Verkehrsinfarkt befindlichem Standort Wuppertal wurde eine ähnliche Entwicklung beobachtet. Die Wuppertaler Stadtwerke konnten eine Verdreifachung der „Studentenfahrten“ messen. In Dortmund nutzten ca. 40% der Studierenden die Bus- und Bahnangebote. Ebenfalls eine Steigerung um den Faktor drei.
In den anschließenden Nachverhandlungen wurde an allen „Ticketstandorten“ über zusätzliche Linien und kürzere Taktungen gestritten, wie auch über Erweiterungen des Tickets debattiert. Darunter fällt auch die Mitnahmeregelung einer zweiten Person. Es folgten aber auch stetige Preissteigerungen. Anstelle von 84 Mark kostet der VRR-Anteil am Semesterticket nun 102,60€ (zzgl. NRW-Erweiterung 42,40€).
Erweiterung auf NRW
Seit 2008 (in Wuppertal seit dem Sommersemester 2009) gilt die Erweiterung des Semestertickets auf das gesamte Bundesland NRW. Erste Bestrebungen kamen 2002 von Seiten der ASten in NRW auf. Heute haben fast 80% der Studierenden das landesweit gültige Ticket. Mit messbaren Erfolg: Die Fahrtenzahlen im Nahverkehr stiegen im Jahr der Einführung um über 30% auf fast 24 Millionen. Gerade Studierende, deren (Heim-)Fahrten nicht durch das bisherige Semesterticket gedeckt wurden, profitieren vom NRW-Ticket. Neben der gesteigerten Mobilität, erfahren auch soziale und umweltorientierte Faktoren einen weiteren Zuwachs. Eine Umfrage an der Uni Bielefeld bescheinigt dem Semesterticket eine hohe Akzeptanz.
Was fehlt denn dann noch?
Gesamtgesellschaftliche und individuelle Vorteile werden im Semesterticket vereint. Doch gibt es noch Möglichkeiten das Semesterticket sinnvoll zu erweitern? In der Umfrage zur rechten Seite findet Ihr einige mögliche Optionen zur Abstimmung. Eure Idee ist nicht dabei? Dann kommentiert diesen Artikel hier oder im Facebook auf unserer Fanpage. »mw«


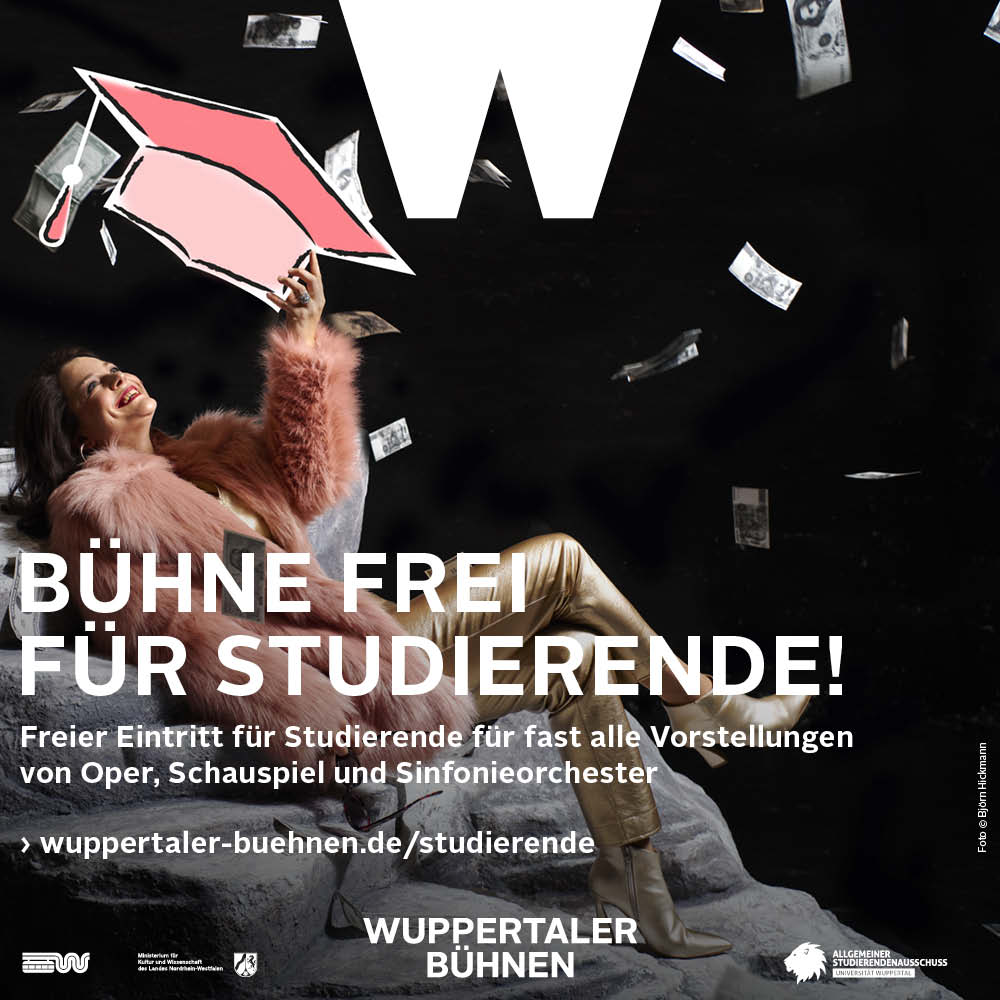










zieht man die hochschulstatistik zu rate und überschlägt grob die entfernungen zwischen hochschule und angegebenen semesterwohnorten, kann man zu dem ergebnis kommen, daß die entfernungskilometer in der zeit von 2006 bis 2013
– im raum wuppertal um 10% zugenommen haben,
– auf mittlerer entfernung bis 30km um 34%,
– auf weiterer entfernung 30-60km um 25%.
insgesamt sind die entfernungkilometer für die einfache strecke in dem zeitraum um 29% gestiegen – leider sind in der hochschulstatistik 1/3 als „sonstige“ nicht berücksichtigt.
bei dem anstieg der studierendenzahlen von 39% in dieser zeit
– +11% im raum wuppertal,
– +28% bis 30km,
– +30% 30-60km
läßt dies auf eine enorm hohe akzeptanz UND abhängigkeit schließen.
dabei sind erfaßt:
– wuppertal
– remscheid, solingen, mettmann, ennepe-ruhr-kreis, hagen, leverkusen, düsseldorf, essen,
– rheinisch-berg.-kreis, neuss, köln, oberbergischer, märkischer kreis, mönchengladbach
im interesse der studierendenschaft sollten die asten damit keinen spökes anstellen, nur aufgrund verletzter eitelkeiten.
manchmal ist „informiert sein“ auch eine holschuld !
t.t.
Gut recherchiert, viele Infos & Quellenangaben. Gefällt mir! 🙂